Teil 2: Konkurrenz und Konflikte
Fortsetzung des 1. Teiles der Gasthofgeschichte.
Die frühe Chemnitzer Gasthofgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts war von bitteren Zeiten und harten Auseinandersetzungen geprägt. Im Schatten des Dreißigjährigen Krieges und wiederholter Pestwellen kämpften die etablierten Gasthöfe ums Überleben und gegen unliebsame Konkurrenz.
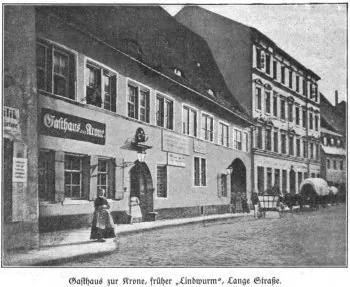 Bereits im Jahr 1628, als die Auswirkungen des Krieges auch Chemnitz erreichten, schlugen die fünf alteingesessenen Wirte – Elias Bock, Georg Silberschmidt, Hans Rüdel, Hans Glantz und Hieronymus Schneider – Alarm. Sie betrieben renommierte Häuser wie den „Güldenen Bock“, die „Güldene Eule“, die „Drei Schwanen“, den „Weißen Bock“ und das „Weiße Roß“. In einer Schrift an den Rat beklagten sie die verheerenden Folgen von Pestjahren und wirtschaftlicher Stagnation. Kaum Reisende kehrten ein, und selbst wenn, reichte der Verdienst kaum für die hohen Betriebskosten und Abgaben. Besonders bitter stießen ihnen die „Winkelwirte“ auf, Handwerker wie Gerber, Bäcker, Schmiede und Seiler, die unerlaubt Reisende beherbergten und ihnen das Geschäft streitig machten. Die etablierten Wirte sahen ihre Existenzgrundlage bedroht und befürchteten, zu Bettlern zu werden, wenn das Treiben der Winkelwirte nicht unterbunden würde. Der Rat zeigte Verständnis und verbot den Winkelwirten die Gastung, doch diese ignorierten die Anordnung.
Bereits im Jahr 1628, als die Auswirkungen des Krieges auch Chemnitz erreichten, schlugen die fünf alteingesessenen Wirte – Elias Bock, Georg Silberschmidt, Hans Rüdel, Hans Glantz und Hieronymus Schneider – Alarm. Sie betrieben renommierte Häuser wie den „Güldenen Bock“, die „Güldene Eule“, die „Drei Schwanen“, den „Weißen Bock“ und das „Weiße Roß“. In einer Schrift an den Rat beklagten sie die verheerenden Folgen von Pestjahren und wirtschaftlicher Stagnation. Kaum Reisende kehrten ein, und selbst wenn, reichte der Verdienst kaum für die hohen Betriebskosten und Abgaben. Besonders bitter stießen ihnen die „Winkelwirte“ auf, Handwerker wie Gerber, Bäcker, Schmiede und Seiler, die unerlaubt Reisende beherbergten und ihnen das Geschäft streitig machten. Die etablierten Wirte sahen ihre Existenzgrundlage bedroht und befürchteten, zu Bettlern zu werden, wenn das Treiben der Winkelwirte nicht unterbunden würde. Der Rat zeigte Verständnis und verbot den Winkelwirten die Gastung, doch diese ignorierten die Anordnung.
Noch heftiger gestaltete sich der Widerstand gegen die Errichtung neuer Gasthöfe. Als Bastian Schütze 1628 einen Gasthof in der Klostergasse eröffnen wollte, formierte sich umgehend Protest. Die „Fünfwirte“ argumentierten, Chemnitz habe bereits genug Gasthöfe, und ein weiterer Betrieb würde die ohnehin knappe Kundschaft nur noch weiter verteilen. Sie warfen Schütze sogar vor, die etablierten Wirte zu verleumden und schlecht darzustellen. Die Wirte ereiferten sich umsonst. Der Kurfürst gestattete Schütze den Gasthof durch Erlaß vom 19. Juli 1628. Aber ein Unheil kam kurze Zeit später über den „Schwarzen Bären“, wie sein späterer Name war. An einem Sonntagnachmittag, den 12. Juni 1631, wo eine verheerende Feuersbrunst die Stadt „zur Hälfte“ in Asche legte, wurde mit der „ganzen schönen Klostergasse“ auch der neue Gasthof ein Raub der Flammen.
 Auch der Versuch Schützes, die Gasthofgerechtigkeit auf ein anderes Haus zu übertragen, scheiterte am Widerstand der Wirte.
Auch der Versuch Schützes, die Gasthofgerechtigkeit auf ein anderes Haus zu übertragen, scheiterte am Widerstand der Wirte.
Wie Sebastian Schütze wünschte der Schmied Daniel Müller einen neuen Gasthof zu gründen, fand aber denselben heftigen Widerstand der alten Gasthofbesitzer. Müllers Haus in der Langengasse, erklärten sie, ist eine Schmiede und nur als solche hat sie Müllers Vater bis zu seinem Tode vor 2 Jahren angesehen. Jetzt treibt Müller den „verbotenen und schädlichen Verkauf von Hafer“, unterbietet die beiden Nachbar- und andere Wirte und entzieht ihnen die Gäste. Aber in Pestzeiten und bei Truppendurchzügen war er nicht zu sehen, da hielt er sein Haus geschlossen und wollte nicht mehr als andere Bürger und Handwerker sein. Da nunmehr die Gefahr vorüber ist, baut er eine Stallung für 20 Pferde und hatte doch vordem nur einen Kuhstall, stellt Bauernpferde, Salz- und Güterwagen ein und treibt Haferwucher. Auf die Beschwerden der Wirte verbot der Kurfürst am 29. Juli 1628 Müller die „öffentliche Gasthaltung“. Nur von Bauern, für die er arbeitete, sollte er Pferde bei sich einstellen dürfen. Trotz des kurfürstlichen Befehls trieben er im Kriege und nachmals seine Witwe Gastwirtschaft.

Im Jahre 1682 steht der „Rote Hirsch“ rechter Hand vom „Weißen Bock“ und „Weißen Rössel“ in der Reihe der anderen anerkannten und berechtigten Gasthöfe.
Bereits am 21. April 1634 äscherte eine neue gewaltige, „durch Gottes Verhängnis entstandene plötzliche Feuersbrunst zahlreiche Häuser ein, so das beste und schönste Teil der Stadt gewesen“, darunter den „Güldenen Bock“ und die „Güldene Eule“ am Markte. Den „Güldenen Bock“ (zweites Haus von der Ecke des Holzmarkts) erhob, nachdem er „22 Jahre unbedeckt und wüste gelegen hatte“, Bürgermeister Balthasar Schütze, der Sohn Sebastian Schützens, aus der Asche. Ihn schmückte lange Zeit die eingelassene Inschrift: „Dis Haus steht In Gottes Handt, Zum Golden Bock Ist Es Genanndt, 1656.“
Die „Güldene Eule“ (ehemals Markt Nr. 12) erbaute nach Jahrzehnten Bürgermeister Atlas Crusius wieder auf. Nur bis in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts bestanden die beiden Gasthöfe, „lange vor 1748 cessierten“, stellten sie den Betrieb ein.
In dieser Zeit des Kampfes um Marktanteile und Privilegien entstanden jedoch auch neue Gasthöfe. Blasius Biedermann eröffnete 1636 den „Ritter zu St. Georg“, und in den 1670er Jahren kam der „Goldene Stern“ hinzu. Um ihre Position zu festigen, erwirkten die neun Gasthofbesitzer im Jahr 1680 eine Ratsordnung, die ihre „Gerechtigkeiten“ bestätigte und als Markstein in der Chemnitzer Gasthofgeschichte gilt.
Dennoch ebbten die Konflikte nicht ab. Der Fall der „Laterne“ in Niklasgasse in den 1680er Jahren zeigte, dass die Konkurrenz auch von außerhalb der Stadtmauern drohte. Trotz Verbots betrieben die Besitzer der „Laterne“ unerlaubt Gastwirtschaft.
Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg flammte der Streit mit den Winkelwirten wieder auf. 16 Jahre lang, seit 1670, lang kämpften die Wirte gegen drei hartnäckige Konkurrenten, die weiterhin unerlaubt Gastwirtschaft betrieben. Sogar Tobias Biedermann, Ratsherr und Wirt des neuen Gasthofs „Ritter St. Georg“, schloss sich den Klagen an, da die Winkelwirte ihm und den alteingesessenen Betrieben das Geschäft verdarben.
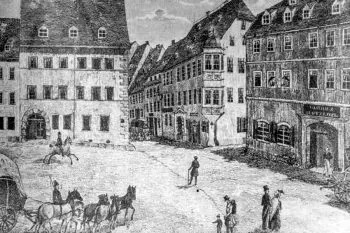
Im frühen 18. Jahrhundert sorgte Bürgermeister Daniel Wagner mit der Errichtung des Gasthofs „Goldene Sonne“ in Gablenz erneut für Aufruhr. Obwohl die Wirte zunächst widerwillig zustimmten, widerriefen sie ihre Einwilligung nach Wagners Tod und versuchten vehement, die Weiterführung des Gasthofs durch Wagners Stiefsohn Christian Plattner zu verhindern – jedoch erfolglos.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts zeichnete sich jedoch ein Wandel ab. Der Zustand der Chemnitzer Gasthöfe hatte sich derart verschlechtert, dass selbst der Rat Missstände beklagte. Zeitgenössische Kritiker bemängelten den schlechten Zustand, mangelnde Reinlichkeit und unzureichende Bewirtung der bestehenden Häuser. Die Etablierung des Gasthofs „Blauer Engel“ im Jahr 1799, trotz des erneuten Widerstands der alten Wirte, signalisierte schließlich, dass die Zeit des strikten Schutzes der alten Privilegien vorbei war und die Notwendigkeit neuer, zeitgemäßer Gasthöfe erkannt wurde, um den Bedürfnissen der Reisenden und der Stadt gerecht zu werden. Die frühe Chemnitzer Gasthofgeschichte spiegelt somit nicht nur den Überlebenskampf einzelner Gewerbetreibender wider, sondern auch den Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in einer Zeit des Umbruchs.
(Quellen u.a. „Chemnitzer Gasthöfe in früherer Zeit“ – Artikel aus den Chemnitzer Nachrichten vom 25. und 31. August 1928; Bericht über alte Chemnitzer Gasthöfe in „Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geschichte“ 1911; Festschrift zur Fünfzig-Jahrfeier der Gastwirt-Innung für Chemnitz und Umgebung 1924)
